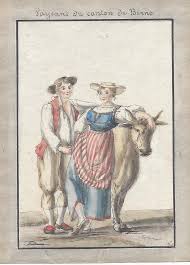Vorab konstitutiert sich die städtische Gesellschaft neu
Neben den Kaufleuten, die höheren Handwerker und ehemaligen Ministralbeamten bildet sich eine neue Oberschicht.
Sie bestand aus neu berufenen Beamten, die z.B. die Mandate der Vögte übernahmen. Jetzt nicht mehr von dem Kaiser
oder Herzog dazu berufen, sondern gewählte Beamte aus dem Bürgertum. Im Prinzip waren es die gleiche wohlhabende Personenschicht
oder von diesen mit einem Amt begünstigt. Von nun an bis heute einfach feudalistisch-demokratisch legitimiert.
Dabei orientierten sie sich ganz auffallend an adligen Vorbildern und setzten auf adlige «Qualitäten».
Sie erwarben Rittertitel und reich verzierte Adelsdiplome, sie kauften Burgen und Herrschaften, sie
lebten und heirateten standesgemäss, und sie übten die wichtigsten politischen und militärischen Ämter aus.
Stefan Frey: Fromme feste Junker.
Neuer Stadtadel im spätmittelalterlichen Zürich, Chronos Verlag Zürich 2017
Stattdessen strebten die ratsfähigen Familien nun in den Dienst der Stadt als Vögte oder Beamte und wurden zu einem
«Verwaltungspatriziat». Adliger Lebenswandel, Repräsentation, die Erwerbung von kaiserlichen Wappenbriefen sowie
der Ritterschlag gehörten dabei zum üblichen äusseren Merkmal dieser neuen städtischen Oberschicht.
Erwin Eugster: Die Entwicklung zum kommunalen Territorialstaat. In: Geschichte des Kantons Zürich,
Bd. 1, Frühzeit bis Spätmittelalter. Werd, Zürich 1995.
Die Begriffe Kuhschweizer und Sauschwaben sind ein Relikt aus der Zeit (Schwabenkrieg).
In der Stadt Zürich gab es Patritzier, die sich von
der bäuerlichen Herkunft distanzieren wollten, um gesellschaftlich mit dem europäischen alten
Adel mit Titeln und anderem Prunk mitzuhalten. Sie
bevorzugten es als eingewanderte und hochgeborene Römer emporstilisiert zu werden, wie es die Innerschweizer Schickeria zu der Zeit tat.
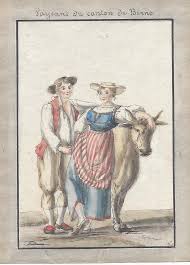
Quelle: Wiki
Der Snob ist also keine neue Erscheinung:
... gern extravagant und glaubt, aufgrund eines entsprechenden
Äußeren oder ausgefallener Interessen besonders vornehm oder intellektuell zu wirken.
[1] blasierter Mensch, Wichtigtuer. Herkunft: nach Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Englischen snob-en übernommen.
Das Wort leitet sich von der englischen Abkürzung "snob" für das lateinische "sine nobilitate" (deutsch: ohne Adel) ab.
Take home message Nr. 1: Minderwertigkeitsgefühl
Ab 1499
Schwabenkrieg (ab Januar 1499) und Frieden von Basel am 22. September 1499
Der Schwabenkrieg – ausserhalb der Eidgenossenschaft auch Schweizerkrieg genannt – war ein Eroberungsfeldzug 1499
der zehnörtigen Eidgenossenschaft und ihrer Zugewandten gegen das Haus Habsburg-Österreich
und dem Schwäbischen Bund (hls).
Vor allem Zürich und Bern hegten gegen Norden Expansionsgelüste, was Gebiete am Rhein aber auch im Elsass betraf.
Die anderen Eidgenössischen Mitglieder hatten aber an einer dauerhaften Eroberung kein Interesse und die lokale
Bevölkerung war den Eidgenossen wegen ihrer Brutalität bereits feindlich gesinnt, hatte deshalb wenig Interesse
an den neuen Herren.
Eidgenössische Tagsatzung 11. März 1499: Jeder, der lebend in der Schlacht in unsere Hände fällt, soll umgehend abgetan werden.
Die Eidgenossen wehren sich gegen den Fortschritt
Als Basel und Schaffhausen zum Bund
beitraten, stellte der Rhein und der Bodensee die natürliche Grenze nach Norden dar.
Noch immer aber waren die Eidgenossen im Heiligen Römischen Reich eingegliedert,
dem sie treu blieben, weil sie auf die Privilegien des Kaisers oder König nicht verzichten wollten.
Eine eigene Nation hatte damals noch niemand im Blick, wie die folgende Abbildung des
Reichsadlers auf der Ämterscheibe von Luzern
auf dem Stadtplan von 1597 zeigt.
(Bild: Galliker, Joseph Melchior, 1972, e-periodica.ch)
Zu der Zeit kam der Begriff der
deutschen Nation auf und wurde bereits in der (Rechts-)Praxis angewandt.
Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts hiess es
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Diese wurde zu der Zeit neu organisiert,
weil die vorhergehende Ordnung den Mitgliedern zu instabil war.
Die Eidgenossen weigerten sich aber damals bspw. die deutsche
Jurisprudenz zu übernehmen.
Schiedsgerichte und dadurch auch mögliche Waffengänge unter den Streitparteien
wurden den
fremden! Richtern noch vorgezogen.
Aufstieg der Söldner zum Wirtschaftsfaktor
Schweizer Söldner wurden darauf der zweitwichtigste Wirtschaftsfaktor im Land, neben der Landwirtschaft.
Die eigenen Kriegsgelüste schwanden dafür mit der in
Marignano 1515 eingesetzten
beweglichen Artillerie der Franzosen, die die bisher erfolgreiche Taktik der alten
Eidgenossen zerzauste.
Die Dienste von einzelnen Söldner oder Regimenter waren bis ins 19. JH. in Europa noch gefragt.
Die unabhängigen Reisläufer wurden zum Ärgernis, während die Söldnerdienste in Verträgen mit den
fremden Mächten geregelt
wurden und ein so gutes Geschäft für die Oberschicht waren
waren, dass der Reichtum der Vermittler ein weiteres lukratives Nebengeschäft
entwickelte: das Ausleihen von Geld mit Zinsen.
Die Söldner hatten einen sehr schlechten Ruf unter der Bevölkerung, weil sie oft Zügelos und Sittenwidrig agierten,
ihre Anführer galten korrupt, die sozialen Folgen durch Verkrüppelungen und Armut unter den Hinterbliebenen unübersehbar.
Erst seit 1929 im Miltärgesetz verboten. Mit einer Ausnahme: die Schweizergarde im Vatikan.
Die moralische Wende kam schweizweit spätestens mit dem Jahr 1709 und der Schlacht von Malplaquet.
Damals leisteten Schweizer Söldner auf beiden Seiten der Kriegspartien Dienst und bekämpften und töteten sich deshalb gegenseitig.
Bei diesem Bruderkampf starben rund 8000 Eidgenossen, was in der Schweiz zu heftigen Diskussionen führte.
Lars Gotsch,Geschichte des Söldnerwesens, SRF, 2021
In Zürich geschah die Wende früher mit Ulrich Zwingli, der nach der verlorenen Schlacht bei Marignano 1515, die er selber miterlebte, sich gegen das Söldnertum einsetzte.
Erneuter Aufstand der Landbevölkerung gegen Zürich
Während der Mailänderkriege (1500–1522) stand Zürich auf der Seite
des Papstes und bekämpfte die Werbung von
eidgenössischen Söldnern für
Frankreich. Die eidgenössischen Kriegszüge nach Mailand zwangen Zürich erneut, auch die Bevölkerung der
Landschaft zum Kriegsdienst
aufzubieten, was nach einer Volksbefragung zunächst geduldet wurde.
Nach der Niederlage bei Marignano (1515),
in der etwa 800 Zürcher
von Stadt und Land fielen, kam es aber auf der Landschaft erneut zu einem Aufstand, da die Söldnerführer aus der Stadt dafür
verantwortlich gemacht wurden. Zudem hungerte die ländliche Bevölkerung (25'000 Personen) und litt unter den Abgaben für die Stadt (6000-10'000 Personen).
Der sog. Lebkuchenkrieg konnte im Dezember 1515 durch die exemplarische Hinrichtung einiger Söldnerführer
beigelegt werden.
Wikipedia
Zürich verzichtet auf das Geld der Söldner
In Zürich kam das Söldnergeschäft bereits 1520 an ihr Ende, als Zwingli ein Verbot des
Dienstes in fremden Mächten im Zuge der Reformation erwirken konnte. Die Folge davon war auch der Wegzug von Söldnerführer aus der Stadt.
Huldrych (Ulrich) Zwingli
Lies die Täufer
ertränken, die eine radikalere uneigennützigere Reform der Religion wünschten.
Führte zum Ende des Söldnerwesens in Zürich. Er war Lehrer des Glarner Chronisten Aegidius Tschudi.
Namensgeber der Tschudikriege. Selbst war er anfänglich von den Ideen des Pazifisten Erasmus von Rotterdam, der in Basel lehrte, begeistert.
Diese persönliche Bindung zerbrach 1513, als Zwingli sich radikalisierte und den Papstglauben (und alles andere) als Sünde verwarf.
Auswirkungen Zwinglis auf Kunst,Kultur und Kapitel
Unter Zwingli wandelte sich die Kultur fundamental. Bilder und Musik wurden verboten, was einem Berufsverbot für
die Künstler gleichkam. Er förderte dagegen die Bildung und Schulen für breitere Schichten, dogmatisierte aber die Lehre.
Neu wurden die Armen geächtet und zur Arbeit angehalten, während sie früher zumindestens
in der Tradition von Christus (Bettelorden) standen.
Noch heute pflegen die Künstler weltweit, jene, die aus katholischen Gegenden stammen, etwas pointierter, diesen Mythos als
Aussenseiter und zugleich von Gottes (Natur)
Gnaden ausserwählt für Besonderes. Das ist zudem gesellschaftlich breit akzeptiert und hebt die Künstler wohlgesinnt in eine
besondere Ecke, im Sinne,
dass sie etwas leisten, auch wenn die meisten nur eine blasse Ahnung davon haben, was diese Leistung beinhaltet.
In den Dekaden nach dem Zweiten Weltkrieg, dem kalten Krieg
und in den neoliberalen Anfängen der 1990iger änderte sich das.
Nicht erfolgreiche KünstlerInnen, einen bescheidene Lebensstandart pflegetn, wurden als Nestbeschmutzer und Nichtsnutze bezeichent.
Die unterste Schicht war schon immer ein beliebtes Ziel von Ressintiments und Neid der breiten Masse.
Mit der Sakularisierung der Sittenwächter, ein Ratsmitglied und einem Kirchenvertreter, wurde mit Zwigli die
Grundlage für jenes Kunstgenre geschaffen, welches
Niklaus Manuel genannt Deutsch (Bern, 1484-1530) bereits in Bern ausübte. Von
der Obrigkeit ausgerufene Sittenlehre auf die Schippe nehmen. Kritik in Form z. B. von feiner Ironie ist ein wichtiges Instrument
der Kunst gegen die falsche Moral von Staatsdoktrinen, bis ins 21. Jahrhundert hinein. Heute sind die Strategien der Mächte subtiler, die
Verhältnisse verworrener und entsprechend schwierig Gut und Böse zu definieren. Der Anfang zu diesem Problem, kann man beim
Protestantismus sehen, der Zürich in spröde Bahnen fuhr, die bis heute anhalten.
Protestantismus hat zweifelsohne die Demokratisierung der Gesellschaften vorangetrieben. Sie hat aber auch totalitäre Züge, wie jede Idee, die,
wie Kant es später ausdrücken würde, versucht ist, aus krummen Holz, wie es der Mensch nun mal sei, etwas Gerades zu machen.
Reformation und ihre Folgen
1529 und 1531 Schlacht bei Kappel
Bei Kappel verlor Zwingli, der den Bürgerkrieg weiter angeheizt hatte,
als Soldat die Schlacht und sein Leben gegen die Fünf Orte, die den alten Glauben behalten wollten. Auswirkungen auf Zürich war demnach, dass
die Expansion der Reformation bei den Innerschweizer Bündnisspartnern vom Tisch war. Danach orientierten sich die Nachfolger von Zwingli in Zürich mit Bern Richtung Westen,
wo in Genf Calvin residierte.
Dreissigjähriger Krieg und Westfälischer Frieden
Ende der Loyalität der Eidgenossen mit dem Kaiser und Reich. Die Souvernität der Eidgenossen nimmt Gestalt an.
Die Neutralität wird erstmals 1674 erwähnt im Holländischen Krieg Ludwigs XIV gegen die Niederlande, das Reich und Spanien.
Der Grund war die Einsicht der militärischen Schwäche und der damit verbundenen Nichterfüllen der vertraglichen Pflichten
die Freigrafschaft Burgund gegen Frankreich zu beschützen (Thomas Maissen). Ab 1700 gilt die Neutralität als Staastmaxime
und wurde verklärend bis auf die Gründung der Eidgenossen rückdatiert.
Johann Heinrich Hottinger 1653
Religiöser Bürgerkrieg 1656 und 1712
Johann Jakob Bodmer
Helvetische Gesellschaft 1761
Diese Gesellschaft versuchte in der Zeit des Ancien Régime die Helvetische Republik ideell wie institutionell neu zu erfinden.
Die Idee über die
Sprach- und Religionsgrenzen hinaus das Sozial- Bildungs- und Armeeeangelegenheiten im Verbund zu regeln und zu organisieren,
die Gleichheit und Freiheit aller Mitglieder kam nicht überall gut an und wurde teils harsch kritisiert bis auch teilweise
als revolutionäres Treiben gedeutet, obwohl sich die Gründer bekräftigten nur Vorschläge zu machen.
Die Gründerväter zogen sich den wegen den Repressionen zurück. In der Folge veränderte sich die Stossrichtung der Bewegung mehrmals
und endete als Vorlage
der Offiziersgesellschaft als ein Instrument von verklärtem patriotischem Gedankengut 1858 in der Neuen Helvetischen Gesellschaft, die 1914 reaktiviert wurde. Heute ist
diese aufgegangen in der Rencontres Suisses – Treffpunkt Schweiz (RS-TS) und tritt wieder unter
demselben Namen u. a. für die Funktionsfähigkeit der demokratischen Institutionen ein.
Mitglieder aus Zürich:
- Stadtarzt Hans Caspar Hirzel 1725-1803,(Im Buch "Die Wirtschaft eines philosoph. Bauers" (1761) beschrieb H. das landwirtschaftl.
Mustergut des Jakob Gujers, genannt Kleinjogg, in Wermatswil. Gujer war ein Bauer und Reformer in der Landwirtschaft. H.
setzte sich später auch mit den Auswirkungen der Frühindustrialisierung auseinander).
-
Dichter und Maler Salomon Gessner 1730- 1788 (nach ihm ist die Gessnerallee benannt, Mitglied Zunft zur Meisen (Wirte, Weinhändler und Maler),
ab 1761 war er Teilhaber von Orell, Gessner & Co. (1770-1798 Orell, Gessner, Füssli & Co.),
dem bedeutendsten Verlag der Aufklärung in der Schweiz (HSL).

Gessner galt aber auch als Teil des Zürcher Bürgertums, das sich gegen politische Veränderungen wehrte. Das Streben nach Aufklärung mündete in einer Verdrängung der Realität, in einer Suche nach
harmonischem aufgeklärten und menschenwürdigen Dasein. Aber nur für denselben Stand. Die Utopie einer Gesellschaft, in der alle
davon profitieren, kam in der Welt des Zürcher Bürgertums - damals wie heute - nicht vor.
Zürichs Ratseliten und die Aristokratie
Die Wirtschaft begann zu florieren. Das Verlagssystem, indem städtische Händler Patentnehmern auf
dem Lande erlaubte Manufakturen zu betreiben, trieb den Export an. Gleichzeitig gab es aber
immer mehr staatliche Aufgaben, die durch Verwaltungsbeamte umzusetzen waren. Die reformierten Eliten hatten
bisher alle diese gutbezahlten Jobs unter sich verteilt, so wie auch die Macht in den Städten nur in den
Händen weniger Familien lag. Wie resolut die Obrigkeit war, zeigte sich, als nur nach vehementer Intervention von Pestalozzi
1794 die Rädelsführer aus Stäfa, die sich auf die Gleichheit ihres Standes auf Papiere um 1500 beruften, nicht hingerichtet wurden.
Neureichen Händler und die Beamten opponierten hingegen weiter, trotz der Drohungen. Es entbrannte auf vielen Ebenen ein Wiederstand gegen das alte System.
Voltaire war einer der Anführer, der gleiche Rechte für alle forderte (Männer). Zürich wehrte sich lange dagegen,
die Aristokratisierung des 18. JH. rückgängig zu machen.
Freiheit dank Wohlstand
Was der Kapitalismus verspricht und dann doch nicht für alle einlösbar werden sollte, wie sich heute abzeichnet, hat auch
Zürich bereits damals zu seinem Prinziperhoben, als Begründung für den Weiterbestand des Absolutismus einzelner Familien.
Die Freiheit des Einzelnen, die durch ein Staatsgewaltmonopol geschützt wird, das auch individuelle Vermögen von Bürgern
ausserhalb der Stände schütze
und die moderne Wirtschaft erst entstehen liess, die wir heute haben, setzte sich erst mit der Revolution in Frankreich durch.
Ansonsten wäre Zürich Teil einer Republik mit ständischen reformierten Räten geblieben.
Erst als die Waadt die Franzosen zu Hilfe rief,
um sich gegen die Patrizier aus Bern, Solothurn und Freiburg militärisch wehren zu können, in der Ostschweiz und Basel bereits die Untertanen im Parlament sassen,
führte Zürich erzwungenermassen die Rechtsgleichheit und Verfassungsräte ein, um Unruhen zu vermeiden.
Zürich und seine Untertanen
1795 beantragte eine Oberschicht aus Stäfa
die Gleichbehandlung bezüglich Rechte und Steuern wie die Stadtbürger, die Abschaffung des Zehnten sowie die Gewerbefreiheit.
Als Antwort besetzten die reaktionären Zürcher die Seegemeinde. Durch die Fürsprache u.a. von Aufklärern wie Heinrich Pestalozzi wurden die Todesurteile
gegen die Stäfner nicht vollzogen. Erst nach dem Ancien Régime, also nach der Besetzung der Schweiz 1798 konnte durch die Franzosen
die demokratischen Freiheitsgedanken gegen die Kräfte der Ständischen für alle umgesetzt werden.
Freimaurerei, 1771, Zürcher Loge Modestia cum libertate (Ehrenmitglied Franz Liszt). Logen waren der Aufklärung dienlich und waren Gegenspieler der religiösen Gruppierungen. Und dies
obwohl im englischen wie deutschen Raum, das erste Gebot die Akzeptanz eines Gottes unwidersprechbar und einziges Tabu war/ist.