Zusammenfassung der Lage
Angesichts des strukturelle Wandel des Öffentlichen Raums durch die Sozialen Medien, die Verflechtung von Wirtschaftsinteressen und Privatheit – der auch auf den musealen Bereich zugreift – könnte man auf diesen freien Öffentlichen Raum beharren und ihn als Oppositionsfläche zurück fordern.
So in etwa lautet die Expertise von Frazer Ward von 1995. Lang ist es her. Er vergleicht verschiedene institutionskritische Ansätze (Haacke, Wilson, Buren, Rodtschenko, Eichhorn) miteinander und zieht als Fazit, dass aus dem "konservativen" Blickwinkel von Jürgen Habermas (J. Habermas, The Structural Transformation of the public sphere) zumindest die Chance darauf besteht, einen Diskurs zu führen, der die aktuelle konzeptlose Förderpolitik für die Bildende Kunst in konstruktivere Bahnen lenken kann. Allerdings: Nur in einem diskutablen engen Sprachkorsett kann der Kunst auch innerhalb der Institution einen Raum zugestanden werden, der nur die Repräsentanz seiner Selbst beinhaltet. Sprachliche Diversität dient hier der Sache f%uumlr einmal also nicht. Deshalb darf Idealistisch mit einem konservativen Flair genannt werden. Man will zuerst das Ziel erreicht haben, bevor man es vielleicht ganz aus den Augen verliert. Im Grunde ist es eine Neubewertung kunsthistorischer Ereignisse mit mehr lokaler und technischer Gewichtung. Beide schaffen eine Transparent durch die ihre Kleinräumigkeit oder ihre pysikalische Präsenz. Ein Überdenken und Verbessern von bestehenden Konzepten, die auf alten Fundamenten aufbauen. Keine Revolution.
Fehlende Kontrollinstanzen
Der grosse Brocken ist der Filz ausVerflechtung von Kapital und Privatheit, der in den Institutionen sich über die Jahrzehnte eingespielt hat. Innovation findet nur dort statt, wo sie als diese eine reale Reduktion der Leistung verschleiert. Man initiert ein neues "jugendliches" Gef6aumlss im Keller, das durch Studenten und externen Geldern günstig zu realisieren ist und legitimiert dadurch den gesetzlichen vorgeschriebenen Innovationszwang und die Einbindung in das lokale Kunstgeschehen. Dadurch verliert nicht nur die freie Szene auch noch Fördergelder. Der Vorteil daran ist, dass der Tagesbetrieb davon nicht betroffen ist, keine Kosten anfallen und jedes dieser Projekte kann jederzeit fallen gelassen werden. Es sind dieselben Kräfte udn Mechanismen, die zurzeit unsere Demokratie schwächen. Sogar die NZZ bemängelt den schwächelnden Gemeinsinn in der Gesellschaft. Kulturelle Institutionen verhalten sich nicht anders als grosse Unternehmen. Institutionen sind Einheiten der öffentlichen Verwaltung und suchen letztlich nur Sicherheit und Stabilität aus Eigennutz. Jede Veränderung von Aussen wird als persönlicher oder existenzieller Angriff gewertet. Die Politik tut dagegen nur wenig. Sie geht davon aus, dass eine Institution sich von Innen verändert und die Vorstände dazu gewählt sind, die Entwicklungen nötigenfalls zu korrigieren. Wenn dies nicht funktioniert, gibt es keine demokratische Möglichkeiten mehr einzugreifen. Sie ist dann auf die Empörung und den Idealismus von Aussen angewiesen. Diese Empörung oder Initiative tritt aber nur auf, wenn die lokale Gesellschaft an den Prozessen in den Museen beteiligt ist und an ihnen emotional teilhat. Dazu muss sie adäquat informiert sein über Inhalt und Form. Politisch und institutionell über den Journalismus und fachlich liegt es in der Hoheit der Kunstwissenschaften die Öffentliche Meinung zu informieren. Sie könnte nicht qualifizierte Tendenzen innerhalb der Institutionen erkennen und den engen "konservativen" Rahmen den J. Habermas favorisiert, herstellen. Ihre Analyse beinhaltet aber nur Gegenwart und Vergangenheit. Zeitgenössische Tendenzen wird von der Kunstkritik bearbeitet.Kunstwissenschaften und Kunstkritik
Bisher hatten die kunsthistorischen wie kunstwissenschaftlichen Institute kein Interesse an einer Veränderung. Ihre institutionelle Repräsention und Wertigkeit haben sich erst in den 1990iger gegen die Laienurteile der Bürgerlichen durchgesetzt, resp. man hat beidseitig gelernt sich zu arrangieren, sich die Plattformen zu teilen (Kein neuer Lehrstuhl ohne Mäzene, keine Hochschule ohne bürgerlichen Support). Schon in den 1980iger, als das Ansehen der Kunst in der Gesellschaft sank (Juppies und 1980iger Ästhetik) gingen beide Parteien lieber dem Konflikt aus dem Weg. Das viele Geld, das bis zur Finanzkrise 2009 zur Verfügung stand, gab ihnen genug Spielraum. Eine karakterlose Wette auf Kosten der Substanz der Kunst, die sie verloren haben, aber heute nicht selber auslöffeln mögen. In den kleineren Städten der Schweiz kamen irgendwann Allianzen zustande, wie z. B. in Bern mit dem Zentrum Paul Klee. Weder touristisch noch kunsthistorisch relevant, wurde ein Mahnmal ür den Nichtangriffspakt zwischen den denkerischen, unternehmerischen und feudalistischen Elite auf die grüne Wiese gestellt. Kritik, um die Öffentlichkeit zu informieren und die Kunst zu schützen, blieb aus.Die Untätigkeit und Schwäche hat dazu geführt, dass ein dritter Player, das private Kapital, ungehindert seine Macht ausbauen konnte. Wie ein Krebsgeschwür, zapft er die Fördergelder der staatliche Institutionen an. Nicht immer so unverfroren, wie es der aktuelle Präsident Philipp Hildebrand des Kunsthaus Zürichs kann, der jüngst die Anlegestrategie der SammlerInnen für schützenswerter hielt als die internationale Reputation des Hauses. Wenn möglich hat er damit sogar Recht. Vielleicht aber bringt dieser Affront die Zürcher Stadtregierung endlich mal zur Besinnung. Mit den Eliten, sagt selbst Hildebrand gemäss Inside Paradeplatz: „Mit der Globalisierung der Unternehmenskultur hat sich teilweise sicher auch die Verbundenheit mit lokalen Institutionen abgeschwächt.“, ist nicht mehr zu rechnen.
Das Fördersystem fährt in die falsche Richtung
Ein Museum der Gegenwart muss in seiner Strategie kritikfähig und transparent sein. Die Kommunikation muss im Öffentlichen Raum stattfinden. Das Publikum muss eingebunden sein, damit nicht die Institution oder Einzelinteressen repräsentiert sind, sondern alle demokratisch legitimen Mitglieder der Gesellschaft kommen auf den Prüfstand indem sie direkt in Kontakt mit dem Kunstschaffen kommen. Wesentlich ist dabei die authentische Quelle für die auszustellende Kunst. Für die Institution kunstgeschichtlich überblickbar und glaubwürdig durch ihre transparente Produktionbedingungen. Dieses Kriterium erfüllt nur das lokale Kunstschaffen. Die Zuführung externer internationaler Qualität macht erst dann Sinn, wenn die lokale Produktion auf dem gleichen diskursiven und wissenschaftlichen Niveau behandelt wird. Das schliesst zwischenzeitliche anregende Gefässe nicht aus, reduziert sie aber deutlich.
Eine institutionskritische Kunstkritik könnte versuchen, hier auch noch einmal aktiver vorzugehen
und Modelle und Vorschläge zu entwickeln,
was gute Institutionen sein können.
Beate Söntgen, 2018.



1. Gruppenausstellung, 2024, Temporärer Kunstraum, Klingenstrasse Zürich 2. Gruppenausstellung "verbinden" Helmhaus 3. Ausstellungsansicht Hauser & Wirth 2024
Kulturarbeit hat durch das heutige System einen schlechten Ruf
Die "Logik der Polizei", wie Rancière das Wesen der Verwaltung (nicht abwertend) nennt, die Millionen von öffentlichen Geldern dem Erhalt einer offensichtlichen Ungerechtigkeiten oder Verschwendung (Kunstmarkt, Kunsthandel und den Erben von Nachlässen) zukommen lässt, bringt immer zyklische Ressentimentsschübe hervor, die die politische Glaubwürdigkeit untergraben. Deshalb hat die hohe Kultur (und mit ihr die Kunst) heute einen schlechten Ruf und der Wille, sich damit auseinanderzusetzen, bessert sich auch nicht durch die pädagogisch anmutenden Maßnahmen der Stadt und des Kantons, das Niveau an die Laien anzupassen. Im Gegenteil, es beweist dem Kritiker gerade, wie auswechselbar und beliebig die Kultur aktuell gestaltet ist. Respekt holt man sich bei Kindern ja auch nicht durch Anbiederung.
Die Funktionäre riskieren das Potenzial der Kunst (Kultur) in der Gesellschaft zur Stütze der Demokratie fahrlässig. Sie braucht die Kunst (Kultur), um die ungesunden Entwicklungen des Kapitalismus abzufedern. Tut sie das nicht, wird der Kapitalismus zum totalitären System. Der Anfang ist gemacht, wie Philipp Loser im Magazin schreibt ("Wer ist grausamer, wer ist zynischer", 07.07.2024).
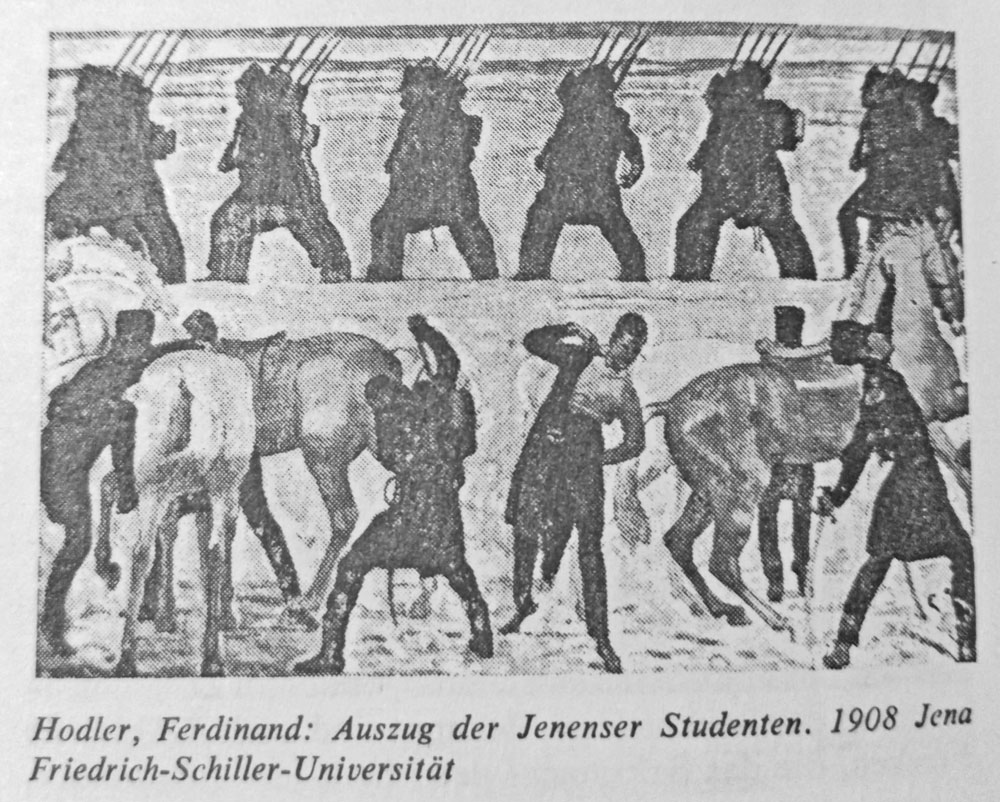
Wie ein Kunstmuseum das lokale Kunstschaffen fördert
Es ist die soziale, intellektuelle und künstlerische Reibungsfläche der Kunstschaffenden. Es ist der Ort des Wettbewerbes, wo Ideen und Umsetzung in Echtzeit verhandelt werden, aber auch mit Kunst der Gegenwart, der Moderne oder mit Arbeiten der Klassiker verglichen werden kann.Es ist der Ort wo die Kunstschaffenden auf die Kunstinteressierten treffen und sich auf Einladung durch das Museum austauschen. Das Museumspersonal führt die Veranstaltung durch, sieht seine Rolle, ausser bei der kunstgeschichtlichen Einordnung, im Hintergrund als Dienstleister.
Selbstbewusst auf das lokale Kunstschaffen fokussieren, wie das 100 Jahren bereits Ferdinand Hodler (1853-1918) einmal erfolgreich einforderte, als der Nationalstaat als Gesellschaftskitt in Mode war. Das war ihm auch gelungen, weil die einheimischen MalerInnen der Zeit, sich mit den den Kunstschaffenden aus Rom, Berlin oder Paris messen konnten. (Bild: Lexikon der Kunst, verlag das europäische buch, westberlin, 1981)
Wie die Stadt profitiert
Ein Kunstmuseum lokaler Prägung wäre bedeutend nachhaltiger und wirtschaftlicher für die Stadt, als es alle bestehenden Institutionen der Kunst in ihrer gegenwärtigen Ausrichtung zusammen sind. Bei den Kunstschaffenden das Material einzuschränken, indem nur ökologisch unbedenkliche Stoffe verwendet werden dürfen, wie dies das Amt für Kultur ausschreibt, ist nicht nachhaltig, sondern an der Stelle absurd, wenn nicht sogar öhnisch im Verältnis von Ursache und Wirkung der gesammten Umweltproblematik. Es beweist, dass das Amt bereits in kafkaesken Höhen mit einer neu besetzten internen Nachhaltigkeitsbeauftragtenstelle schwingt, statt sich konrekten Problemen zu widmen. Nachhaltigkeit bedeutet hier etwas anderes, wie wir weiter unten ausführlicher beschreiben.Was kann man tun?
In der heutigen Realität des Kunstsystems Zürich fehlt diese Grundlage. In den meisten europäischen Grossstädten ist die Förderung dazu übergegangen, die Subkulturen soweit zu unterstützen, dass sie im Alltag der Bevölkerung ein niederschwelliges Angebot anbieten kann. Der Trick dazu ist u.a. den mangelnden Ausstellungsraum gerechter aufzuteilen. Anstatt pro Haus einen Chefkurator auszuwählen, der weitere Kuratoren nach seinem Gusto engagiert, werden mehrere Kuratoren mit unterschiedlichen Profilen ausgewählt, die die Breite des Kunstschaffens besser abdeckt und gemeinsam das Haus bespielen. Also nicht, wie in Zürich, eine homogene Gruppe pro Haus zu installieren, setzt man auf heterogene Leitungen, die sich untereinander stimulieren. Darüber hinaus wird die Ausstellungskadenz erhöht, um auch Platz für das Angebot zu schaffen.Dadurch entsteht dann viel eher wieder eine breite Akzeptanz des Kunstschaffens im Lokalen und für das Publikum ein vielfältiges Programm an einem zentralen Ort, wie sich das der Kunstförderung der Stadt Zürich auf dem Papier vorschwebt.
Der → Blick in das Ausland zeigt auch, dass Grossstädte von einem regen lokalen Austausch profitieren und deswegen die Attraktivität für Touristen nicht sinkt. Es werden sogar eine Reihe von neuen Jobs entstehen, die den Kunstschaffenden als Einkommensgrundlage dienen.
Konkrete Massnahmen haben anfangs trotzdem wenig revolutionären Karakter:
Die Berührungen zwischen der lokalen und der global ausgerichteten Szene werden nicht speziell gefördert. Sie funktionieren autonom und sind für beide Seiten möglich, aber für keine der Seiten wirtschaftlich essentiell. Die Kommunen müssen nur darauf achten, dass ihre Gelder bei grossen Institutionen nicht vom Markt (oder von Direktorengehälter) zweckentfremdet werden. Damit schliesst sich der Kreis. Die Macht der grossen Häuser über 96% der Kulturgelder muss mit der Förderung des lokalen Kunstschaffens verbunden sein. Sie ist der Leistungsausweis. Auf den Statutenpapieren steht das teilweise sogar explizit. Nur umgesetzt wird es weder von den Leitungen der Institutionen, noch von der Aufsicht, den Vorständen, oder von der Überaufsicht, der Politik.
